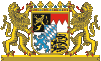Mehr Biodiversität für Außenanlagen am Standort Kitzingen
Artenvielfalt und neue Mitbewohner am AELF Kitzingen-Würzburg
Auf dem Außengelände des AELF Kitzingen-Würzburg, Standort Kitzingen, zählen ökologische Gesichtspunkte mehr als vermeintliche Schönheit und dabei verzichten wir vor Ort nicht auf Pflege. Aber im Vordergrund steht nicht die Optik, sondern die gezielte Förderung neuer Lebensräume für Flora und Fauna. Im Frühsommer summen zum Beispiel Wildbienen auf den sandigen Flächen, auf denen Bodendecker (Cotoneaster bzw. Zwergmispel) wachsen.
Die neue Außenanlage soll vielen Menschen – Landwirten, Privatleuten, Unternehmern – Anregungen geben und ein anschauliches Vorbild darstellen, wie man auf dem eigenen Grund und Boden die Artenvielfalt fördert.
Aktuelles Projekt
Um das Außengelände des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen attraktiver für Insekten zu machen, wandeln wir die Grünflächen zu dauerhaften Blühflächen um. Man kann nicht immer nur von Artenschutz reden, man muss auch selber etwas dafür tun, meinen wir. Wir halten Sie auf dem Laufenden:
Februar 2024
Klimabäume am Standort Kitzingen
Biodiversität auf den blühenden Flächen in Kitzingen 2022
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Sonnenbad
Juni 2021: Neues Sandbeet bereichert die Nachhaltigkeit am Standort Kitzingen

Der Klatschmohn taucht das Beet in üppiges Rot
Neben der Ansaat wurden im Herbst trockenheitsverträgliche Stauden gepflanzt – so setzen Schwertlilie (Iris germanica) oder Natternkopf (Echium vulgare) weitere Akzente und bieten Insekten eine Nahrungsgrundlage.
Die bestehende Pflanzenvielfalt wird dabei in ihrer Zusammensetzung in den nächsten Jahren keineswegs starr bleiben. Ein grundlegender Aspekt der Biodiversität ist die hohe Dynamik – einige Pflanzen werden nicht mehr so zahlreich erscheinen oder gänzlich verschwinden, andere Pflanzen setzen sich hingegen durch und etablieren sich auf Dauer.
Neben der Ansaat und der Staudenpflanzung wurden heimische Rosen und andere insektenfreundliche Sträucher wie die blau blühende Bartblume (Caryopteris clandonensis) gepflanzt. Besonders bei den Rosen ist ein Augenmerk auf ungefüllte Blüten zu legen. Nur so kommen Biene, Hummel und Co. an Nektar und Pollen. Auch hier konnten sich die Pflanzen gut etablieren. Das für Kitzinger Verhältnisse relativ feuchte Frühjahr war ein Glücksfall für die Neuanlage. Die Pflanzenauswahl ist sehr trockenverträglich, die ersten beiden Jahre der Anwachsphase wird aber nach Bedarf gegossen. Diese kleine "Wasserinvestition" führt schließlich zu einer etablierten, pflegearmen Blühfläche, die in Zukunft auch ohne Bewässerung auskommt.
Weitere Ansprechpartner zur Artenvielfalt
- für Bürger: Gartenakademie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim
- für Bürger: Örtliche Gartenbauvereine und Gartenbaubetriebe – letztere vor allem bei der Umsetzung
- für Kommunen: Grünordner der Abteilungen Gartenbau der ÄELF und das Institut Stadtgrün und Landschaftsbau der LWG
- für Landwirte: ÄELF